Neueste Erkenntnisse zu den Ursachen der ME/CFS
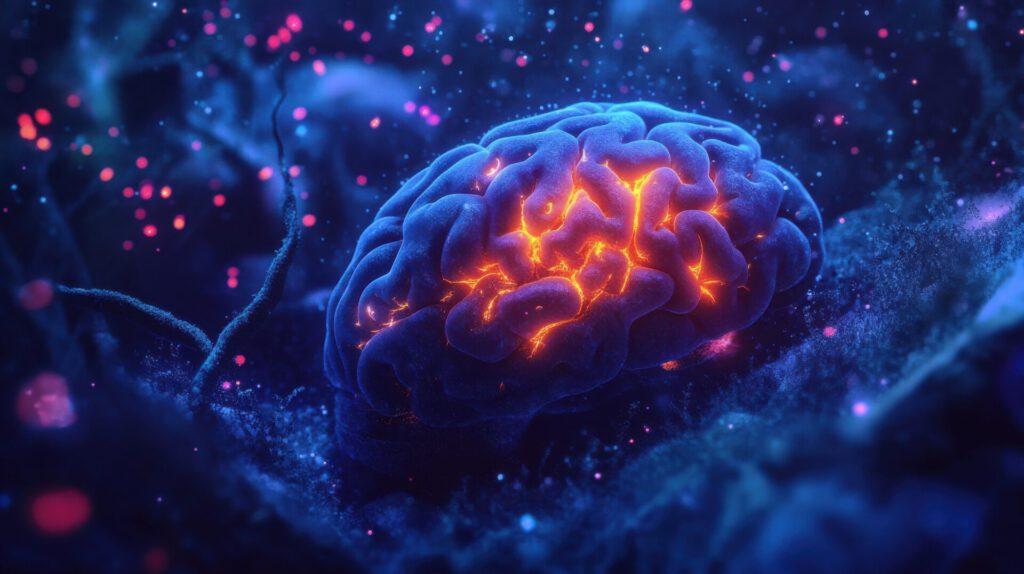
Lipkin-Studie: Bei ME/CFS reagiert das Immunsystem auf Belastung, als handle es sich um eine Infektion
Kurzzusammenfassung
Eine der bisher größten Studien zu ME/CFS liefert neue Einblicke. Das Immunsystem von Betroffenen ist bereits in Ruhe auffällig aktiv, vor allem jedoch nach körperlicher Belastung zeigt sich die entscheidende Fehlsteuerung. Selbst geringe Anstrengungen lösen übersteigerte Entzündungsreaktionen und Energiestress in den Zellen aus.
Untersucht wurden über 200 Personen. Die Diagnose erfolgte nach CCC und nach Fukuda. Blutproben wurden in Ruhe, unmittelbar nach einem Belastungstest sowie 24 und 72 Stunden später analysiert.
Entzündung als Dauerzustand
Bereits in Ruhe zeigte sich im Blut der ME/CFS-Betroffenen eine Vielzahl erhöhter Zytokine. Zytokine sind kleine Botenstoffe des Immunsystems, die Entzündungsreaktionen steuern. In der Studie waren unter anderem IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-17, TNF-α und IFN-γ deutlich erhöht. Ein Auswertungsmodell beschrieb dieses Muster als „screams baseline immune activation“, also als Immunprofil, das förmlich nach chronischer Aktivierung schreit (Che et al., 2025; Johnson, 2025).
Wenn die isolierten Immunzellen zusätzlich mit bakteriellen oder viralen Stimuli konfrontiert wurden, reagierten sie übersteigert. Besonders bei Frauen nach der Menopause fiel die Reaktion stark aus. Lipkin führte dies im Gespräch mit David Tuller auf den Einfluss von Östrogen zurück, das normalerweise dämpfend wirkt. Mit abnehmendem Spiegel verlieren die Immunzellen offenbar eine wichtige Bremse und antworten noch aggressiver auf Reize (Tuller/Lipkin, 2025).
Ein weiterer Zusammenhang ergibt sich aus der Darmforschung. Lipkins Gruppe hatte bereits zuvor gezeigt, dass Menschen mit ME/CFS weniger Bakterienarten besitzen, die Butyrat herstellen. Butyrat ist eine kurzkettige Fettsäure, die einerseits die Darmschleimhaut schützt und andererseits überschießende Entzündungen bremst. Fehlt dieses Schutzmolekül, wird die Darmbarriere durchlässiger und mikrobielle Produkte gelangen leichter ins Blut. Dort treffen sie auf ein Immunsystem, das ohnehin überaktiviert ist, mit Folgen wie grippeähnlichem Krankheitsgefühl, kognitiven Einschränkungen und Post-Exertional Malaise (Tuller/Lipkin, 2025).
Diese dauerhafte Aktivierung passt zu ersten Befunden aus der Hirnforschung. Prof. Jarred Younger konnte in einer (zu diesem Zeitpunkt) noch unveröffentlichten PET-Studie zeigen, dass Immunzellen im Gehirn von ME/CFS-Betroffenen auffällig aktiv sind. Darüber hat #MillionsMissing Deutschland 2025 bereits berichtet. Die Lipkin-Studie ergänzt diesen Befund nun durch klare Blutdaten, die systemische Entzündung sichtbar machen (MillionsMissing, Neuroinflammation, 2025).
Energieblockade
Die Studie zeigt deutlich, dass die Zellen von Betroffenen mit ME/CFS bei körperlicher Belastung nicht in den normalen Trainingsmodus wechseln. Normalerweise greifen Muskelzellen auf verschiedene Energiequellen zurück: erst Zucker, dann zunehmend Fette. Bei ME/CFS gelingt dieser Wechsel nicht.
Citrate und Phosphate: Statt in den Muskelzellen für die ATP-Produktion genutzt zu werden, sammeln sie sich nach Belastung im Blut an. Das weist auf eine Störung im Energiestoffwechsel hin.
GDF15: Dieses Signalprotein stieg bei ME/CFS deutlich an. GDF15 ist ein Marker für mitochondrialen Stress. Mitochondrien stellen nicht nur Energie in Form von ATP her, sie steuern auch zentrale Prozesse der antiviralen Abwehr. Wenn sie überlastet sind, bricht daher nicht nur die Energieproduktion ein, sondern auch die Fähigkeit, Infektionen und Entzündungen zu kontrollieren.
Carnitin und Fettsäuren: Bei Gesunden steigt Carnitin nach Belastung an, um Fette in die Mitochondrien zu transportieren. Bei ME/CFS fiel es ab, die Fette wurden kaum genutzt.
Das Ergebnis ist eine metabolische Inflexibilität. Der Stoffwechsel bleibt in einer Art Blockade stecken, anstatt flexibel zwischen Zucker- und Fettverbrennung zu wechseln.
Für Betroffene bedeutet das: Schon geringe Belastungen können eine Symptomkaskade auslösen, die weit über Fatigue hinausgeht. Typisch sind verschärfte Schmerzen, kognitive Einbrüche, grippeähnliches Krankheitsgefühl oder neurologische Störungen. Genau diese verzögerte und vielschichtige Reaktion definiert Post-Exertional Malaise (PEM). Sie unterscheidet ME/CFS von anderen chronischen Erkrankungen und ist ein zentrales Diagnosekriterium. Für Fachleute ist dieser Befund bedeutsam, weil er zeigt, dass PEM durch messbare Störungen im Energiestoffwechsel erklärbar ist und nicht auf mangelnde Fitness zurückzuführen ist (Che et al., 2025; Johnson, 2025).
Leber im Notfallprogramm
Die Lipkin-Studie zeigt, dass auch die Leber bei ME/CFS in eine Art Notfallprogramm gezwungen wird. Normalerweise balanciert sie zwischen zwei zentralen Aufgaben: Energie bereitzustellen und Giftstoffe abzubauen. Bei den Betroffenen lag der Schwerpunkt deutlich auf der Entgiftung.
Glucuronsäure: Bereits in Ruhe war dieser Marker erhöht und blieb auch nach der Belastung hoch. Glucuronsäure entsteht, wenn die Leber versucht, Fremdstoffe und Stoffwechselabfälle zu binden und auszuscheiden. Hohe Werte deuten darauf hin, dass der Körper ständig mit oxidativem Stress und potenziell schädlichen Molekülen kämpft.
Metabolische Inflexibilität: Statt flexibel von „Entgiftung“ auf „Energieproduktion“ umzuschalten, bleibt die Leber im Abwehrmodus gefangen. Dadurch fehlt Energie, die für Regeneration und Belastungsbewältigung gebraucht würde.
Für Betroffene bedeutet dies, dass der Körper schon im Ausgangszustand stark belastet ist. Wenn dann zusätzliche Anforderungen durch Bewegung oder Stress hinzukommen, steht kaum Energie für Muskeln und Gehirn zur Verfügung. Das kann die Schwere und Dauer von Post-Exertional Malaise verstärken.
Für die Forschung ist dieser Befund besonders spannend, weil er zeigt, dass nicht nur Muskeln und Immunsystem, sondern auch zentrale Stoffwechselorgane wie die Leber dauerhaft unter Druck stehen. Damit rückt ME/CFS noch klarer in die Reihe von Erkrankungen, bei denen ein fehlgeleitetes Gleichgewicht zwischen Energie- und Stressreaktionen das Krankheitsbild prägt (Che et al., 2025; Johnson, 2025).
Komplementsystem und Mastzellen
Ein weiterer zentraler Befund betrifft das Komplementsystem, einen Teil der angeborenen Immunabwehr. Es ist normalerweise dafür zuständig, Krankheitserreger schnell zu erkennen und zu bekämpfen. Doch in der Lipkin-Studie zeigte sich, dass dieses System bei ME/CFS nach Belastung übermäßig stark aktiviert wird.
Komplementfaktoren: Nach der Belastung fanden sich erhöhte Spiegel von C1R und CFHR4. Beide Proteine deuten darauf hin, dass das Komplementsystem anspringt, selbst ohne akute Infektion.
Folgen: Eine Überaktivierung kann Mastzellen aktivieren. Mastzellen setzen Histamin und andere Botenstoffe frei, die zu Entzündung, Gewebeschäden, Schmerzen und kognitiver Beeinträchtigung beitragen.
Vergleich mit früheren Studien: Bereits eine CDC-Studie hatte vor Jahren ähnliche Befunde beschrieben und vorgeschlagen, dass das Komplementsystem für die „inflammatorische Komponente“ von PEM verantwortlich sein könnte. Die neuen Daten bestätigen diese Hypothese eindrucksvoll.
Für Betroffene lässt sich das so übersetzen: Ein an sich normales Training oder sogar alltägliche Belastung wird vom Körper wie eine Infektion behandelt. Die überschießende Aktivierung führt zu Symptomen wie grippeähnlichem Krankheitsgefühl, Schmerzen oder Brain Fog.
Für Fachleute sind die Daten bedeutsam, weil sie zeigen, dass ME/CFS keine unspezifische Überlastung darstellt, sondern eine fehlgeleitete Immunreaktion, die direkt messbar ist. Interessanterweise schlagen neuere Reviews auch für Long COVID ähnliche Mechanismen vor, was die Relevanz dieser Befunde über ME/CFS hinaus unterstreicht (Che et al., 2025; Johnson, 2025).
Oxidativer Stress
Die Lipkin-Studie zeigt, dass Menschen mit ME/CFS besonders stark unter oxidativem Stress leiden. Damit ist ein Ungleichgewicht zwischen schädlichen Sauerstoffradikalen und den körpereigenen Schutzsystemen gemeint.
Kupferabhängige Enzyme: Nach Belastung stiegen in der ME/CFS-Gruppe Enzyme wie AOC2 und CUTC deutlich an. Beide sind Teil kupferabhängiger Reaktionswege, die bei erhöhter Bildung von freien Radikalen anspringen.
Folgen: Freie Radikale können Zellmembranen, Eiweiße und Mitochondrien direkt schädigen. Wenn die körpereigenen Abwehrsysteme überlastet sind, entsteht ein Teufelskreis aus Entzündung, mitochondrialem Stress und weiterer Radikalbildung.
Für Betroffene bedeutet dies, dass schon geringe Anstrengungen eine Kaskade in Gang setzen können, die viele Körpersysteme gleichzeitig trifft. Typische Folgen sind kognitive Verschlechterungen, grippeähnliches Krankheitsgefühl oder auch verstärkte Sensitivität gegenüber Reizen. All dies sind Kennzeichen der Post-Exertional Malaise.
Klinische Bedeutung und Konsequenzen
Die Ergebnisse der Lipkin-Studie sind nicht nur für die Forschung relevant, sondern auch für die klinische Praxis.
Diagnostik: Mehrere Marker wie GDF15, Citrate oder Komplementfaktoren könnten künftig helfen, PEM objektiv zu erfassen. Das ist bedeutsam, weil die Diagnose bislang fast ausschließlich auf Symptomberichten basiert.
Verständnis von PEM: Die Studie zeigt, dass PEM keine subjektive Überlastung ist, sondern das Resultat messbarer biologischer Fehlsteuerungen. Damit wird klar, dass die Kernsymptomatik von ME/CFS eine physiologische Grundlage hat.
Forschungsperspektive: Die Vielzahl an Biomarkern eröffnet die Möglichkeit, Subgruppen von Betroffenen zu identifizieren und spezifische Therapieansätze zu entwickeln.
Für Ärztinnen und Ärzte ist entscheidend zu erkennen, dass körperliche Belastung bei ME/CFS pathologische Prozesse auslöst, die durch Laborwerte belegbar sind. Für Betroffene bedeutet dies, dass ihre Erfahrungen zunehmend wissenschaftlich erklärbar und medizinisch anerkannt werden (Che et al., 2025; Johnson, 2025).
